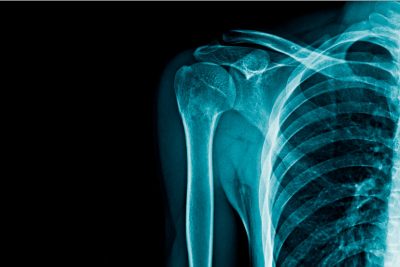Neues Hobby gesucht? – 44 inspirierende Vorschläge
Neues Hobby gesucht?44 inspirierende Vorschläge Neben Arbeit, Kindern und den vielen Verpflichtungen im Alltag ist man oft froh, wenn man sich mit einer Schüssel Popcorn einfach nur ins Sofa fallen und sich vom Fernseher berieseln lassen kann. Doch hin und wieder wünscht man sich, dass da noch etwas anderes wäre. Etwas, auf das man sich nach […]
Zum Beitragbeliebteste Beiträge
- Fisteln: Symptome, Ursachen und Behandlung
- Übersetzungsbüro Wien: Die besten Anbieter
- Sperrmüll Wien: So wirst du deinen Sperrmüll los
- Luftreinigende Pflanzen: So wirst du die Schadstoffe in deiner Wohnung los
- Henna Tattoo! temporäre Tattoos in Wien
- Rückwärtssuche – so findest du den Namen zur Telefonnummer
- Muskelfaszien: Was sind Faszien einfach erklärt?
- Hilfe, Mehlmilben! Kleine weiße Tierchen in der Küche
- Neues Hobby gesucht? – 44 inspirierende Vorschläge
- Skoliose: Wenn sich die Wirbelsäule seitwärts biegt
-
Essen gehen während Corona: Welche Richtlinien gelten? Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus war die Gastronomie in Österreich lange Zeit auf Abholung und Lieferung eingeschränkt. Seit 1. Juli 2021 können Restaurants Gäste fast wieder uneingeschränkt vor Ort bewirten. Voraussetzung für den Restaurant-Besuch ist die sogenannte 3G-Regel. Alle Gäste müssen entweder geimpft, genesen oder getestet sein. […]
Weiterlesen -
Als das Griensteidl, das Hawelka und das Prückel gegründet wurden, dachte noch niemand an Rollstuhl, Rollator oder Prothesen. Zwar gab es Menschen mit eingeschränkter Mobilität auch um 1900, doch die Gesellschaft des Fin de Siècle kultivierte diesbezüglich einen blinden Fleck. Heute hat die Wiener Stadtverwaltung sich den barrierefreien öffentlichen Raum auf die Fahnen geschrieben – doch […]
Weiterlesen

Corona Virus: aktuelle Lage in Österreich
Corona Virus: aktuelle Lage in Österreich (29.06.2023) In Österreich sind bisher 6.081.195 Infizierungen (inklusive bereits Genesener und Verstorbener) mit dem Coronavirus (COVID-19) bestätigt worden. Die Zahl der bestätigten Todesfälle durch COVID-19 liegt aktuell bei 22.540, genesen sind im ganzen Land aktuell bereits 6.054.865 Menschen. Bis einschließlich 28. Juni wurden 20.094.471 Impfdosen verabreicht. 1.719.449 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten […]
Zum Beitrag